

AGil entwickelt Geschäftsmodelle für Stadtwerke im ländlichen Raum, um Erneuerbare Energie lokal zu nutzen – mit Wasserstoff, Speichern und flexiblen Verbrauchern für eine erfolgreiche und gesellschaftlich akzeptierte Energiewende.
AGil steht für Akteurstimulierende und sektorkoppelnde Geschäftsmodelle für Stadtwerke im ländlichen Raum. Das Projekt entwickelt innovative Geschäftsmodelle für kommunale Energieversorger und Verteilnetzbetreiber, um Stromüberschüsse aus Wind und Solar lokal nutzbar zu machen.
Ein zentraler Baustein ist die Integration von Wasserstofftechnologien: Statt Strom zu negativen Preisen zu exportieren, soll er vor Ort in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert werden.
Das Projekt untersucht vor diesem Hintergrund, wie eine dezentrale, intelligente Steuerung der Stromnetze zusammen mit Speicherlösungen und flexiblen Verbrauchern – etwa Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge oder eben Elektrolyseure – effizient betrieben werden kann. In interdisziplinären Teilprojekten werden technische, ökonomische, rechtliche und politische Rahmenbedingungen analysiert.
Ziel ist ein übertragbares Governance-Modell, das Stadtwerke befähigt, gezielt zu investieren und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. AGil schafft damit die Grundlage für eine nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige und gesellschaftlich akzeptierte Energiewende – mit Wasserstoff als Schlüssel zur lokalen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit.
Projektpartner sind die Professur für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung der Universität Göttingen, das Institut für Politikwissenschaft der Universität Göttingen, das Institut für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme der TU Clausthal, die Sonderforschungsgruppe interdisziplinäre Institutionenanalyse (sofia) an der Hochschule Darmstadt, die Harz Energie Netz GmbH, die Stadtwerke Göttingen AG und die Stadtwerke Uslar GmbH.
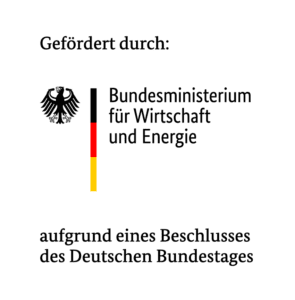
„AGil – Akteurstimulierende und sektorkoppelnde Geschäftsmodelle für
Stadtwerke im ländlichen Raum“ wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.










Das Innovationsnetzwerk Wasserstoffwirtschaft für Südniedersachsen verfolgt das Ziel, die energetische Transformation rund um Wasserstoff voranzubringen sowie die Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen sukzessive weiterzuentwickeln. Im Fokus steht die Projektentwicklung, die entsprechend der regionalen Bedarfe weiter ausgebaut werden soll. Zu diesem Zweck wird ein koordiniertes Innovationsmanagement entwickelt.
Das Land Niedersachsen fördert InnoNetH2 für drei Jahre mit insgesamt rund 130.000 Euro über die Zukunftsregion Südniedersachsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).


Südniedersachsen ist nicht Teil des geplanten bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes. Die Machbarkeitsstudie „Wasserstoffnetz Südniedersachsen: Potenziale und Entwicklungspfade“ beleuchtet, wie die Region die wegweisende Transformation in Richtung einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft dennoch gestalten kann. Dafür wurden die Erdgasverteilnetze untersucht und Wasserstoffbedarfe in den Landkreisen Göttingen, Goslar, Hildesheim, Holzminden, Northeim sowie der Stadt Göttingen für 2037 und 2045 identifiziert.
